Ziele
Als Gymnasium der Stadt Geldern entwickeln wir ein breites Spektrum an Fähigkeiten, die den Anforderungen unserer komplexen Gesellschaft gerecht werden. Zugleich bereiten wir gemeinsam mit den Eltern die Schüler auf eine ausgewogene Lebensweise vor. Künstlerisches Profil Als ehemaliges Mädchengymnasium trägt unsere Schule eine gestalterische Prägung und bietet neben qualifiziertem Unterricht im Fach Kunst ab der Klasse 8 Ergänzungen zum das künstlerische Profil wie das Fach Literatur und Theater. Dabei nutzen wir die Ressourcen unserer vorhandenen Aula mit Theateraufführungen, Lesungen und anderen Veranstaltungen. Der ganzheitliche Bildungsansatz unserer Schule bietet Raum für die Entwicklung der Persönlichkeit, für Lernerfolge und für die Kreativität unserer Schüler. Sprache Sprachliche Fähigkeiten fördern wir durch die vorgezogene zweite Fremdsprache Französisch. Ein besonderes Augenmerk gilt unserer Muttersprache Deutsch. Neben den Fächern Englisch und Latein kann ab der Klasse 8 die Fremdsprache Niederländisch belegt werden. In der Oberstufe bieten wir Dank der Kooperation mit unserem Nachbargymnasium die Fächer Italienisch und Spanisch an. Das Abitur Ziel unseres Gymnasiums ist es, alle Schüler bis zum Abitur zu führen und dabei ihre Zielstrebigkeit und Selbstständigkeit zu unterstützen. Differenzierter Unterricht, und individuelle Förderung sichern dabei gute Lernchancen für alle Schüler. Zunehmend legen die Schüler ihre Teilziele selbst fest im Dialog mit Lehrern, Kursleitern und Eltern. So beugen wir Leistungsdefiziten vor und fördern Talente. Gemeinschaft Es ist uns wichtig, eine Gemeinschaft zu schaffen und nach außen offen zu sein. Bei Ritualen wie beim täglichen gemeinsamen Mittagessen sowie in größeren Projekten und Veranstaltungen und beim Lernen an außerschulischen Lernorten erproben und stärken wir die Gemeinschaft.
Schulgeschichte in Stichworten und Bilder
I. Unsere Vorgänger:
1. Städtische Höhere Mädchenschule (1824-1920)
1824 Erste Erwähnung einer Städtischen Höheren Mädchenschule. Die Schule hatte nur eine Klasse und befand sich im Kloster Hüls auf der damaligen Dammerstraße (heute Hülser-Kloster-Gasse).
1866 Übernahme der Schule durch die "Schwestern unserer lieben Frau"
1874 Auflösung der Schule während des Kulturkampfes
1875-1879 Weiterführung durch weltliche Lehrkräfte
1880 Neueröffnung einer Städtischen Mädchenschule
1893-1897 Die Zahl der Schülerinnen schwankt zwischen 20 und 40.
1897 Umzug in ein neues Schulgebäude am Südwall
2. Lyzeum Marienschule (1920-1938)
1920 Erneute Übernahme der Schule durch die Schwester unserer lieben Frau. Die weltlichen Lehrer werden übernommen.
1926 Umzug in ein Gebäude am Westwall
1938 Den Schwestern wird durch die nationalsozialistische Regierung verboten, neue Schülerinnen für die Sexta aufzunehmen.
Es wird eine neue Sexta für Mädchen am Kreisjungengymnasium eingerichtet.
3. Oberschule für Jungen und Mädchen (1938-1945)
1939 Das Lyzeum wird endgültig aufgelöst. Die Klassen werden vom Jungengymnasium übernommen, das sich von nun ab Oberschule für Jungen und Mädchen nennt. Das Gebäude am Westwall wird von der Wehrmacht übernommen.
1942 Erste Reifeprüfung für Mädchen in Geldern
1945 Der Unterricht findet zunächst für die Schüler und Schülerinnen wieder im Gebäude am Westwall statt, da das Jungengymnasium von den Besatzungstruppen benötigt wird.
1946 Umzug der Jungen- und Mädchenklassen zum Gebäude an der Issumer Landstraße.
Die Leitung beider Schulen hat Dr. Franzen, der Direktor des Jungengymnasiums.
II. Das Gymnasium
1. Progymnasium für Mädchen (1952-1957)
1952 Die Mädchenschule wird wieder selbständig und bezieht wieder das Gebäude am Westwall.
Regina Korte wird Schulleiterin
Die Schule hat 218 Schülerinnen.
1954 Genehmigung zum Ausbau der Schule zur "Vollanstalt"
1955-1958 Anbau eines neuen Flügels
1957 1. Reifeprüfung
2. Mädchengymnasium (1957-1965)
1961 Regina Korte tritt in den Ruhestand.
Neue Leiterin: Dr. Marianne Hartmanns
1962 Gründung der SMV (Schülermitverwaltung)
1964 Beginn der Partnerschaft mit einer Schule in Nimwegen
3. Neusprachliches Mädchengymnasium und Frauenoberschule, später Gymnasium für Frauenbildung (1965-1977)
1965 Der Schule wird ein neuer Zweig angegliedert: die Frauenoberschule bzw. das Gymnasium für Frauenbildung
Umzug in das neue Gebäude am Friedrich-Nettesheim-Weg
1965-1978 Zahlreiche Schulopern von Gregor Vos unter Mitarbeit von Lindner und Droege/van der Grinten.
Szene aus der Oper "Die Sanduhr"
1971 Die Zahl der Schülerinnen hat sich in den letzten 6 Jahren verdoppelt. Sie betrug nun 808.
1972-1974 1. Versuch einer Oberstufenreform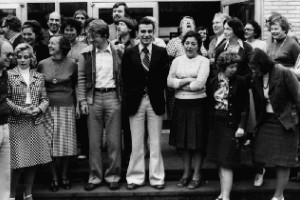
Ein Teil des Kollegiums
1973 Rückkehr zur alten Reifeprüfungsordnung
1975 Schülerinnen werden mit 18 Jahren volljährig.
1975 Der Kreis Geldern wird aufgelöst. Der Kreis Kleve wird Träger der Schule.
1976 Gründung des Fördervereins
1976-1978 Die Handballmannschaft wird dreimal hintereinander NRW-Meister
4. Mädchengymnasium (1977 -1988)
1978 Schulmitwirkungsgesetz
Tod von Dr. Hartmanns
Ernst Hammans wird Schulleiter
Ein erster Schülerberg erreicht die Schule.
Sie hat 1092 Schüler.
1981 Beginn der Kooperation mit dem Friedrich-Spee-Gymnasiums
1982 Jubiläumsfeier, Herausgabe einer Festschrift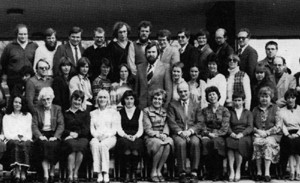
Kollegium
1983 Erster Reflexionstag zur Drogenprophylaxe
Einführung eines unterrichtsfreien Samstags im Monat.
1984 Zum ersten Mal finden Projekttage statt.
1985 Beginn der Partnerschaft mit der Schule in Antony.1986 Erste Berufsorientierungswoche
Einführung der Koedukation
1987 Die Volleyballmannschaft der Mädchen wird Vize-Meister von NRW
1988 Wechsel der Trägerschaft vom Kreis Kleve zur Stadt Geldern
5. Lise-Meitner-Gymnasium (seit 1988)
1988 Die Schule bekommt einen neuen Namen.
Erst sollte sie nach Joseph Beuys benannt werden, dagegen sprach sich aber der neue Schulträger aus. Deshalb entschied man sich für Lise Meitner als Namensträgerin.
Die Tennismannschaft der Mädchen wird Vize-Meister von NRW
1990 Die Schule wird anlässlich des letzten Schultags der Jahrgangsstufe 13 zum ersten Mal verpackt.
Ulrike Meyers wird Bundessiegerin beim Schülerlotsenwettbewerb.
Ernst Hammans geht in Pension.
1992 Dr. Hubert Fischer wird neuer Leiter der Schule.
1993 Einführung des freien Samstags
Eine Theatergruppe nimmt unter Leitung von Herrn Schüler am Landes-Schülertheater-Treffen teil. Sie gewinnt auch noch den Kulturpreis der Stadt Kevelaer.
1995 Der letzte Mädchenjahrgang macht Abitur.
Beginn der Partnerschaft mit dem Lyceé Lakanal in Sceaux.
Die Volleyballmannschaft wird Vizemeister von NRW.
1996 Eine Theatergruppe unter Leitung von Frau Schenk erhält den Jugendkulturpreis.
1997 Die Tennismannschaft der Mädchen gewinnt, nachdem sie dreimal hintereinander Vize-Meister geworden war, endlich die Landesmeisterschaft und fährt nach Berlin zur Deutschen Meisterschaft.
Ein Grundkurs Kunst von Frau Soppa erhält den 2. Preis beim Heinrich-Heine-Wettbewerb der Stadt Düsseldorf.
Eine Theatergruppe unter Leitung von Frau Schenk nimmt am Landes-Schülertheater-Treffen teil.
1998 Französisch als erste Fremdsprache neben Englisch
Kollegium im Jahre 1998:
2000 Die Schule bekommt einen neuen Oberstufentrakt
Beginn der Partnerschaft mit italienischen Schulen
2002 Die Schule richtet die Deutsche Schülerbumerangmeisterschaft aus
Feier des 50-jährigen Bestehens mit Projekttagen und "LMG im Schaufenster"
2003 Beginn der Partnerschaft mit einer polnischen Schule aus Konin (Polen).
2007 Erstes Zentralabitur und Zentralprüfungen in Klassenstufe 10
2008 Einführung des Nachmittagsunterrichts mit Mensabetrieb
2010 Dr. Fischer geht in den Ruhestand
2010 Dr. Diehr wird neuer Schulleiter
2011 Dr. Fischer stirbt, am Rande des Schulhofes wird ein Baum zum Gedenken gepflanzt
2011 Mittagstisch in der neuen Mensa
2013 Der Doppeljahrgang macht Abitur (Letzter G9-Durchgang, erster G8-Durchgang)
2025 Der letzte G8-Durchgang macht Abitur
Ziele
Nach einer Vorbereitungsphase im Januar 2017 hat die Qualitätsanalyse NRW das Lise-Meitner-Gymnasium Anfang September 2018 besucht. Das Ergebnis lässt sich in einem Satz zusammenfassen, wie das Prüferteam unter Leitung von Herrn Peller meinte: Das LMG ist eine richtig gute Schule!
Dem können wir natürlich nur zustimmen und freuen uns, dass auch andere unsere intensive und erfolgreiche Arbeit würdigen.
Nachdem Herr Peller bereits 2017 mit Schülern, Eltern und Lehrern einige zusätzliche Aspekte festgelegt hatte, wurden wir vom 10.09. bis zum 13.09.18 besucht. An drei Tagen im September fanden zahlreiche Unterrichtsbesuche statt, außerdem führten die Qualitätsprüfer Interviews mit Schülern, Eltern, Lehrern, den Sekretärinnen, dem Hausmeister und der Schulleitung. Natürlich wurde auch das Schulgebäude besichtigt. Im Zentrum der Untersuchung standen neben den Feldern „Erwartete Ergebnisse“, Wirkungen“ und „Rahmenbedingungen und verbindliche Vorgaben“ vor allem das „Lehren und Lernen“, die „Schulkultur“ sowie der Bereich „Führung und Management“. Die Einzelheiten können Sie dem ausführlichen Bericht entnehmen, die wesentlichen Punkte werden im Folgenden erläutert.
Im Abstimmungsgespräch 2017 war neben den obligatorischen Aspekten der folgende Schwerpunkt vereinbart worden:
Weiterentwicklung der Arbeit an der Förderung der Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern unter Berücksichtigung des sozialen Klimas, der Teamstrukturen der Lehrkräfte und der räumlichen Bedingungen.
Außerdem waren wir sehr gespannt, wie die aus unserer Sicht intensive Weiterarbeit in den von uns ausgewiesenen Bereichen von außen gesehen wird:
• Stärkung der Naturwissenschaften: (AGs in 5 und 7, WP II: NaWi, Wettbewerbsteil-nahme; Neugestaltung eines weiteren Biologieraumes, Einrichtung eines Chemie-LKs 2018/19)
• Weiterentwicklung des neuen Förderkonzepts in den Stufen 5 und 6: „Lerncafé“ und „Lerncafé plus“; u.a. auch Ausstattung mit IPads spätestens Frühjahr 2019
• Hausaufgaben-Konzept einschließlich Hausaufgabenplaner
• Konsequenzen aus SEIS 2015: Bestätigung der Schülersprechstunde, Weiterentwicklung der Schülerfeedbackbögen (SEfU)
• Chancen einer Europaschule unter den Bedingungen der Dreizügigkeit: Aus-landspraktika, Einrichtung einer stabilen AG?
• Entwicklung Medienkonzept, u. a. Einrichtung des Projektkurses „Lise-App“, AG 5. Klasse PC & Office
Am 13.09. war es dann soweit – das Prüferteam präsentierte auf einer Konferenz Lehrern sowie interessierten Schülern und Eltern ihre Ergebnisse. Uns wurde bescheinigt, dass wir besondere Stärken auf den folgenden Gebieten haben:
• Von Respekt und Wertschätzung geprägte Schulkultur in einem vorbildlichen sozialen Klima als Grundlage von Lernen und Leben
• Anspruchsvolles, attraktives und vielfältiges unterrichtliches sowie außerunterrichtliches Profil
• Engagierte Förderung sozialer und personaler Kompetenzen der Schülerschaft
• Vorbildliche Mitgestaltung des schulischen Lebens durch Schülerschaft und Eltern
• Positive Lernhaltung der Schülerschaft
• Zugewandte und umfängliche Beratung der Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Erziehungsberechtigten
• Gesicherte Basisqualitäten guten Unterrichts
Als Entwicklungsfelder der Schule wurden benannt:
• Langfristige Ausrichtung der vielfältigen Arbeitsfelder im Sinne des Qualitätszirkels durch die Systematisierung von Zielen und Indikatoren der Zielerreichung, Maßnahmen und Meilensteinen, Verantwortlichkeiten, Evaluationen und Feedback im Sinne einer mehrjährigen Arbeitsplanung
• Intensivierung individualisierender und differenzierender Lernarrangements im Unterricht
• Ausbau der Faktoren selbstgesteuerten Schülerlernens in unterrichtlichen Prozessen
Nach der abgeschlossenen Arbeit der Qualitätsanalyse musste unsere Schulkonferenz gemeinsam mit der Schulaufsicht eine Zielvereinbarung treffen. Wir haben uns nach intensiver Diskussion für die folgenden Schwerpunkte entschieden:
Das Konzept des Lerncafés soll auf Klasse 7 ausgeweitet werden, um Elemente selbstgesteuerten Lernens zu verstärken. Außerdem soll sich eine einzurichtende Schulentwicklungsgruppe aus Eltern, Schülern, Lehrern und der Schulleitung um die mehrjährige Planung von Entwicklungszielen kümmern und die architektonische Gestaltung des Schulgebäudes auf die pädagogischen Bedarfe abstimmen.
Ziele
Als Gymnasium der Stadt Geldern vermitteln wir eine vertiefte allgemeine Bildung, die unsere Schülerinnen und Schüler zur Aufnahme eines Studiums befähigt und für eine berufliche Ausbildung qualifiziert. Unser Ziel ist es, alle Schüler bis zum Abitur zu führen und dabei ihre Zielstrebigkeit und Selbstständigkeit zu unterstützen. Der Unterricht ermöglicht die Auseinandersetzung mit komplexen Problemstellungen und leitet unter einer wissenschaftspropädeutischen Perspektive zu abstrahierendem, analysierendem und kritischem Denken an.
Neben dem Erwerb von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten stehen die Entfaltung künstlerisch-kreativer Potenziale sowie die Übernahme sozialer und ethischer Verantwortung im Zentrum unseres Bildungsauftrags. Dazu gehört selbstverständlich die Förderung der Entwicklung von Toleranz, Solidarität und Verantwortungsbewusstsein.
Mittelfristige Entwicklungsziele gemäß Schulprogramm:
1. Stärkung der Naturwissenschaften.
Durch mehrere Maßnahmen konnten in den letzten Jahren die naturwissenschaftlich-technischen Fächer in der Sekundarstufe I gestärkt werden. Dazu zählen regelmäßig angebotene naturwissenschaftliche AGs in den Jahrgangsstufen 5 und 7 sowie ein neu eingerichtetes Fach im Wahlpflichtbereich II („NaWi“) mit einem experimentellen Schwerpunkt. In dieselbe Richtung zielt auch der großflächige Einsatz von Schülerexperimentierkästen im Fach Physik. Die räumliche Situation wurde durch den systematischen Umbau der naturwissenschaftlichen Fachräume deutlich verbessert. So ermöglichen jeweils zwei Physik-, Chemie- und Biologieräume ein zeitgemäßes Arbeiten (letzter Umbau: Chemieraum 2016). Ein weiterer Biologieraum muss noch umgebaut werden. Die regelmäßige Durchführung naturwissenschaftlicher Veranstaltungen (u.a. zur Sonnenfinsternis, Stratosphärenballon) sowie die Teilnahme an Wettbewerben (u.a. Jugend forscht, Roberta) sollen das Interesse an Naturwissenschaften stärken.
Ein noch nicht erreichtes, aber weiter angestrebtes Ziel ist die breitere Anwahl von naturwissenschaftlichen Leistungskursen in der Sekundarstufe II. Dabei sollen unter der Bedingung vorhandener Ressourcen Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase zusätzliche Unterstützung bei einer Wahl von Chemie- und Physik-Leistungskursen erhalten.
2. Auf dem Weg zur Europaschule?
Angesichts der Vielzahl von Austauschprogrammen (Frankreich, Italien, Polen, Niederlande) sowie der deutlich überdurchschnittlichen Ergebnisse unserer Schülerinnen und Schüler in zentralen Prüfungen auf diesem Gebiet wird aktuell u.a. im Rahmen von Fortbildungen geprüft, welche Schritte sinnvoll und notwendig sind, um eine weitere Stärkung bereits vorhandener Kompetenzen zu erreichen und eventuell auch die Bedingungen für Europaschulen zu erfüllen.
Medienkonzept
Neben den oben genannten Zielen ist der planvolle Ausbau der Medienkompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler ein weiteres Ziel. Aktuelle Bausteine sind etwa die Internet-Schulung für die 6. Klassen sowie die Einrichtung einer zertifizierten Medienscout-Gruppe seit dem letzten Schuljahr. Eine Arbeitsgruppe entwirft aktuell ein neues Medienkonzept mit den Schwerpunkten „Leben mit Medien“ und „Lernen mit Medien“, um so den Kompetenzerwerb im Umgang mit den digitalen Medien des 21. Jahrhunderts zu stärken. Speziell zum Einsatz von Tablets und Smartphones ist in diesem Zuge zu klären, ob ein BYOD-Konzept, eine 1:1-Lösung oder der Einsatz seitens der Schule angeschaffter einheitlicher Geräte (Klassensatz) zu bevorzugen ist. Bedingung für eine tragfähige Entscheidung ist allerdings die Orientierung des Schulträgers und dessen Planung im Bereich Netzausbau sowie eine angemessene Unterstützung der IT-Betreuung im Sinne der Rahmenvereinbarung zwischen Land und Kommunen.
Weitere Ziele:
Die SEIS-Untersuchung des Jahres 2015 hat als Handlungsschwerpunkt eine intensivere unterrichtlichen Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern benannt (Handlungsfeld 2: „Lernen und Lehren – Unterricht“, vgl. Qualitätstableau NRW). Um dies zu erreichen, wird eine aus Schülern und Lehrern bestehende Steuergruppe Feedbackbögen erstellen, die dann zum Einsatz kommen werden. Außerdem wird im Schuljahr 2016 probeweise am Elternsprechtag eine Schülersprechstunde eingerichtet.
Um die Diskussion aller innerschulischen Akteure zu verstetigen (Handlungsfeld 3: „Schulkultur“), wurde darüber hinaus eine Schulentwicklungsgruppe aus Eltern, Schülern, Lehrern und Schulleitung gegründet. Ihre erste Aufgabe ist die Prüfung einer sogenannten Aktionswoche.
Lise Meitner
Lise Meitner wurde am 17. November 1878 als drittes von acht Kindern einer Wiener Rechtsanwaltsfamilie geboren. Sie besuchte die Volksschule und die Bürgerschule in Wien und hatte damit das für Mädchen vorgesehene Bildungsziel erreicht. Um studieren zu können, musste sie sich in Privatkursen auf das externe Abitur vorbereiten, eine schwere Aufgabe: 14 Mädchen stellten sich der Prüfung; sie war eins der vier, die sie bestanden. Physik wollte sie studieren, weil naturwissenschaftliche Phänomene sie von Kind an beschäftigt hatten. Doch vorher machte sie nach dem Willen der Eltern das Examen als Französisch-Lehrerin, um einen sicheren Abschluss zu haben. 1901 beginnt sie das Physik-Studium. 1906 schließt sie es mit der Promotion ab. In dieser Zeit veröffentlicht sie die ersten wissenschaftlichen Arbeiten.
Weil sie ihr Wissen noch vertiefen wollte, ging sie 1907 nach Berlin, wo damals Max Planck lehrte. Um seine Vorlesungen besuchen zu können, benötigte sie, eine Sondergenehmigung, denn in Preußen durften Frauen zu dieser Zeit noch nicht studieren. Für eigene Forschungen wurde ihr nur ein Raum im Keller des Physikalischen Instituts zugewiesen, der Institutsleiter wollte in den Forschungslabors keine Frau sehen.
In der Berliner Zeit kommt es zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem fast gleichaltrigen Chemiker Otto Hahn, der durch ihre Wiener Veröffentlichungen auf sie aufmerksam geworden war. Sie forschten gemeinsam auf dem Gebiet der Radioaktivität und Atomphysik und publizierten zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten. 1912 richtet Max Planck für Lise Meitner eine Assistenten-Stelle ein. Im Ersten Weltkrieg geht sie zwei Jahre als Röntgenschwester an die Ostfront, kehrt dann aber wieder zu ihren Forschungen zurück. Mit Otto Hahn entdeckt sie ein neues Element, das Protaktinium. Für diese Entdeckung werden beide für den Nobelpreis vorgeschlagen.
Ihre Arbeit wird 1918 dadurch gewürdigt, dass sie am angesehenen Kaiser-Wilhelm-Institut eine eigene Abteilung erhält. Ihr Forschungsschwerpunkt sind die noch unbekannten Eigenschaften der Beta- und Gamma-Strahlen, die beim Atomzerfall entstehen. 1922 erhält sie das Recht, Vorlesungen zu halten, 1926 wird sie außerordentliche Professorin.
Lise Meitners Eltern waren Juden sie war aber protestantisch erzogen worden. 1908 hatte sie sich auch evangelisch taufen lassen. Sie könnte sich mit dem Satz identifizieren, den sie einmal von Max Planck zitiert hat: "Nichts hindert uns, die Weltordnung der Naturwissenschaften und den Gott der Religion miteinander zu identifizieren."
Die Machtübemahme der Nationalsozialisten 1933 setzte ihrer Lehrtätigkeit ein Ende. Als Österreicherin konnte sie aber weiter forschen und machte- davon auch Gebrauch, was sie sich später vorwarf. Zusammen mit Otto Hahn und ab 1935 mit Fritz Straßmann beginnt sie mit den Versuchen, die schließlich zur Kemspaltung führen sollten. Aus dieser Arbeit wurde sie 1938 durch den Anschluss Österreichs an Deutschland gerissen. Auf einmal war sie eine deutsche Jüdin und damit aufs höchste gefährdet. Über Holland konnte sie nach Schweden fliehen, wo die inzwischen fast 60jährige am Nobel-Institut in Stockholm unterkam. Aber die Arbeitsbedingungen waren für sie dort denkbar schlecht, und die Lebensumstände waren erniedrigend.
Der Kontakt zu den Forscherkollegen blieb allerdings bestehen, und sie diskutierte in Briefen mit Hahn die Ergebnisse der Versuche, die auch nach ihrer Flucht weitergingen. So erfährt sie auch, dass Ende 1938 Hahn und Straßmann die erste Kernspaltung gelingt, was, beide zuerst nicht glauben können. Auf Grund der übermittelten Daten berechnen Lise Meitner und ihr Neffe Otto Fritsch als erste die Energie, die dabei entstanden ist.
Nach dem Abwurf der ersten Atombombe auf Hiroshima wollen amerikanische Zeitungen Lise Meitner zur "Mutter der Atombombe" machen. Entsetzt betont sie, dass sie nicht den leisesten Anteil an der Entwicklung der Bombe gehabt hat. Auf ihr Ideal von der zweckfreien Forschung ist aber ein Schatten gefallen. Sie muss erkennen, dass hinter jeder wissenschaftlichen Leistung die Gefahr einer missbräuchlichen Anwendung steht Deshalb setzt sie sich für die Ethik der Wissenschaftler ein.
In der Nachkriegszeit erhält sie zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen. Lise Meitner starb am 27. 11. 1968, im Alter von 89 Jahren in Cambridge, wo sie die letzten Lebensjahre in der Nähe ihres Neffen zugebracht hatte. Ihr Wunsch "Das Leben muß nicht leicht sein, wenn es nur inhaltsreich ist ." war in Erfüllung gegangen.
Peter Nieting
( Die Bildrechte hat das Max-Planck-Institut in Berlin , bitte bei Vervielfältigung dort um Erlaubnis bitten)
Schulprogramm
1. Pädagogische Grundorientierung
Die pädagogische Grundorientierung stellt Grundsätze für die gemeinsame pädagogische Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer und Schüler auf; sie gilt deshalb sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrerinnen und Lehrer. Unsere Schule ist ein Ort der Arbeit für Schülerinnen und Schüler, für Lehrerinnen und Lehrer. Das fordert
• Lern- und Anstrengungsbereitschaft bei den Schülern
• fachliches und erzieherisches Engagement bei den Lehrern
• klare Leistungserwartungen
• ein Unterrichtsklima, das konzentriertes Arbeiten ermöglicht
• einen ansprechend gestalteten Arbeitsplatz für alle.
Unsere Schule bildet eine pädagogische Gemeinschaft. Das bedeutet
• ein Verhältnis gegenseitiger Wertschätzung
• Ernstnehmen des Schülers in seiner Persönlichkeit
• Ermutigung statt Drohung als pädagogisches Grundverhalten
• Begegnung mit Respekt und Höflichkeit
• klare Regeln für den Umgang miteinander
• Ansprechbarkeit der Schüler bei Unterrichtsstörungen oder Fehlverhalten
• Kooperation und gegenseitige Unterstützung unter Schülern im Unterricht
• Kooperation und Kommunikation im Kollegium im Hinblick auf ein gemeinsames Handeln
• Kooperation zwischen Lehrern und Eltern in Erziehungsfragen
• Kooperatives Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern im Unterricht.
Unsere Schule bildet ein Modell einer demokratischen Gesellschaft. Das heißt
• Mitentscheidung und Mitverantwortung der Schüler und Eltern im Rahmen der Schulmitwirkung
• Mitwirkung der Schüler bei der Auswahl von Unterrichtsgegenständen
• regelmäßige Verständigung über die geltenden Normen und Regeln
• Bemühen um Gerechtigkeit.
Das vollständige Schulprogramm finden Sie hier:
![]() Das Schulprogramm des Lise-Meitner-Gymnasiums in der aktuellen Version im pdf-Format.
Das Schulprogramm des Lise-Meitner-Gymnasiums in der aktuellen Version im pdf-Format.
Darüber hinaus steht Ihnen hier die Schulordnung zur Verfügung:
![]() Die aktuelle Schulordnung des Lise-Meitner-Gymnasiums im der aktuellen pdf-Format
Die aktuelle Schulordnung des Lise-Meitner-Gymnasiums im der aktuellen pdf-Format
Das LMG
Jede Schule kann Charakter haben. Eine Eigenschaft, die sie unverwechselbar macht, welche Neugierde weckt oder in Erinnerung bleibt. Die Besonderheiten einer Schule interessiert Menschen, die das Eigenleben noch nicht durch eigene Erfahrungen erlebt haben. Wer mehr über unsere Lise wissen möchte, der erhält hier vielfältige Informationen:
Ziele
Schulprogramm
Geschichte unserer Lise
Lise Meitner








